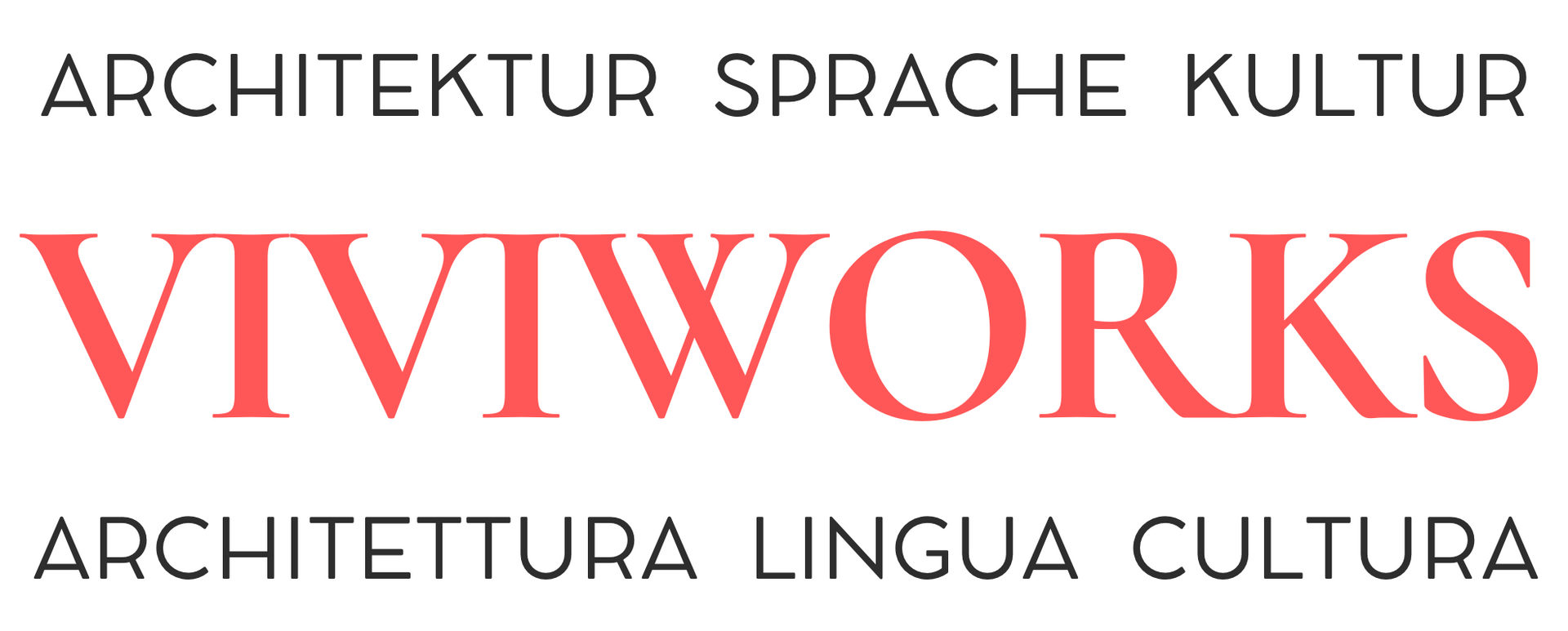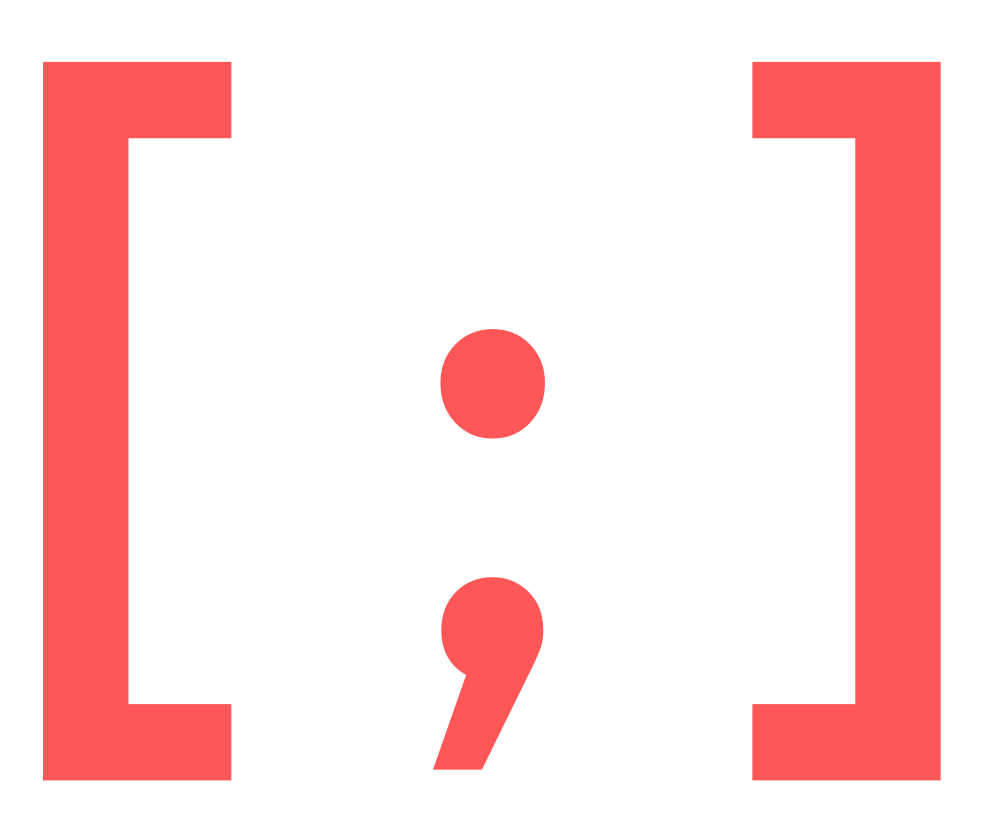
truccare oder türken?
I. Italienische Ursprünge: die doppelte Semantik von truccare
Die Geschichte des deutschen Verbs "türken" beginnt auf den Bühnen der Commedia dell'arte und in den Gassen der Renaissance-Städte. Dort begegnet uns das italienische Verb truccare – ein Ausdruck von bemerkenswerter Ambivalenz. Seit dem 15. Jahrhundert belegt, bezeichnet es sowohl das ästhetische Verfahren des Schminkens als auch den manipulativen Akt der Täuschung. Diese semantische Zweideutigkeit, die der italienische Sprachwissenschaftler Tullio De Mauro als "oscillazione tra creazione e frode" charakterisiert, bildet die kognitive Grundlage für seine spätere Transformation im Deutschen.
Die etymologische Herkunft von truccare ist nicht völlig geklärt. Möglicherweise leitet es sich vom lateinischen trūcāre (in eine bestimmte Form bringen, zuschneiden) oder dem altfranzösischen trucher (täuschen) ab. Entscheidender jedoch ist seine funktionale Doppelheit im kulturellen Kontext der Renaissance: Wie De Mauro in seinem Grande Dizionario dell'Uso Italiano (1999) bemerkt, verbindet es die äußere Verstellung mit der inneren Täuschung: "Il trucco nasconde per mostrare altro, o per mostrare il falso come vero." (Die Schminke/die Täuschung verbirgt, um anderes zu zeigen, oder um das Falsche als Wahres zu zeigen.)
II. Die Wanderung nach Norden: Von truccare zu "türken"
Die Übernahme ins Deutsche erfolgte im 17. Jahrhundert, primär über die Gaunersprache (Rotwelsch), wo truccare phonetisch adaptiert und semantisch spezialisiert wurde. Die lautliche Anpassung zu "türken" (mit Anlaut-T statt Tr- und Vereinfachung der Endung) ist typisch für Entlehnungen in diese Sphäre. Die früheste literarische Fixierung findet sich bei Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen:
"Er türkte die Karten so geschickt, dass selbst der Wirt nichts merkte"
(Simplicissimus Teutsch, 1668, Cap. 10)
Hier operiert "türken" noch im ursprünglichen Kontext der Spielmanipulation. Der Sprachhistoriker Peter von Polenz beschreibt diese Entwicklung in seiner Deutschen Sprachgeschichte (1994) als typisch für Entlehnungen aus dem Romanischen in Bereichen der "höfischen" oder "kriminellen" Kultur, die dann in die allgemeine Umgangssprache diffundieren.
Während die Bedeutung "schminken" im Deutschen nie wirklich Fuß fasste, dominierte von Anfang an die übertragene Bedeutung des Betrugs, der Täuschung und Manipulation. Dies spiegelt den primären Verwendungskontext wider: "die Karten türken", "einen Würfel türken".
III. Die Macht der falschen Assoziation: Volksetymologie und Stereotypenbildung
Hier setzt die entscheidende und sprachhistorisch folgenreiche Fehldeutung ein: Die lautliche Ähnlichkeit zwischen "türken" und dem Ethnonym "Türke" führte zu einer Volksetymologie, die die Bedeutung des Verbs radikal umdeutete und mit negativen Stereotypen auflud.
Das 16. bis 18. Jahrhundert war geprägt von den Türkenkriegen und einer tiefen kulturellen, religiösen und politischen Distanz zum Osmanischen Reich. Martin Luthers Sermon von dem Türcken zu Rom (1529) lieferte das theologische Fundament dieses Stereotyps:
"Der Türke ist ein Meister der Lüge, der mit falschem Frieden lockt und mit heimlichem Verrat sticht"
(WA 30/II, S. 160)
Diese Topik durchdrang die Barockliteratur. Martin Opitz nutzt sie in seinem Werk Trost-Gedichte in Widerwärtigkeit des Krieges (1633) als moralische Chiffre:
"Wer türkisch denkt, der täuscht und bricht"
(V. 42)
Hier wird "türkisch" bereits adjektivisch zum Synonym für hinterhältiges Handeln – ein Indiz für die vollzogene semantische Verschiebung.
Die Wirksamkeit dieser Umdeutung erklärt Karl Jaspers' Konzept der "kollektiven Schattenprojektion" (Psychologie der Weltanschauungen, 1919):
"Das Unbewusste einer Kollektivität projiziert seine eigenen abgewehrten Impulse auf den Fremden."
(S. 246)
Im Fall von "türken" projizierte die deutsche Sprachgemeinschaft ihre eigenen Ambivalenzen gegenüber Täuschung und Manipulation – besonders im Kontext von Handel und Krieg – auf das Stereotyp des "Türken". Elias Canetti diagnostiziert 1960 in Masse und Macht:
"Der Türke wurde zum Inbegriff des heimlichen Verrats, weil die deutsche Seele ihre eigenen Schattenseiten an ihm projizierte"
(S. 412)
Diese psychologische Dynamik transformierte das Verb von einem bloßen Fachterminus zu einem kulturellen Symptom.
IV. Literarische Spiegelungen: Von Grimmelshausen bis Grass
Die Rezeptionsgeschichte des Verbs in der deutschen Literatur dokumentiert seine schrittweise Semantisierung:
In Grimmelshausens
Simplicissimus (1668) bezeichnet "türken" noch Spielmanipulation im Dreißigjährigen Krieg und bedient die Funktion als technische Fachbedeutung.
Bei Thomas Mann in den Buddenbrooks (1901) hat sich die naturalisierende Assoziation bereits verfestigt: "Das ist getürkt! So türken nur die Türken – und die Kaufleute". Hier klingt die Gleichsetzung von "türkisch" und "kaufmännisch" wie eine Selbstverständlichkeit.
Günter Grass schließlich macht in Die Blechtrommel (1959) das Wort selbst zum Thema: "Oskar türkte die Wahrheit, so wie man sagte, die Türken türken". Hier wird die Projektion entlarvt – das Verb wird zum Symbol seiner eigenen missbrauchten Geschichte.
V. Aktuelle Bedeutung und sprachliche Verantwortung
Trotz der volksetymologischen Überlagerung blieb die Kernbedeutung von "türken" weitgehend stabil, erfuhr aber eine Erweiterung:
1. Kernbedeutung: "Heimlich verändern, manipulieren, fälschen, vortäuschen, betrügen". Dies gilt für Dokumente ("die Rechnung türken"), Aussagen ("sein Alibi türken"), Situationen ("einen Test türken") oder allgemeiner ("das ist alles getürkt").
2. Konnotation: Die Bedeutung ist "durchgängig negativ" konnotiert. Die volksetymologische Verbindung zu "Türke" verleiht dem Wort oft eine zusätzliche Nuance des "Hinterhältigen oder Verschlagenen", die über die reine Beschreibung der Handlung hinausgeht. Dies macht es in sensiblen Kontexten oder gegenüber Menschen mit türkischen Wurzeln potenziell verletzend und rassistisch wirkend, auch wenn der Sprecher die etymologische Herkunft nicht kennt.
Die Wissenschaft hat längst bewiesen, dass "türken" nichts mit Türken zu tun hat. Und doch haftet dem Wort etwas an, das über seine etymologische Wahrheit hinausgeht: die Erinnerung an eine Zeit, in der Europa seine Identität durch die Abgrenzung vom "Türken" definierte.
VI. Sprache als Spiegel kollektiver Psychologie
Die Etymologie von "türken" ist mehr als eine akademische Wortgeschichte. Sie ist ein Lehrstück über:
1. Dynamik sprachlicher Entlehnung: Wie das Wort truccare aus einer Sprache (Italienisch) in eine andere (Deutsch) wandert, sich lautlich anpasst und semantisch spezifisiert wird.
2. Macht der Volksetymologie: Wie lautliche Ähnlichkeiten und kulturelle Vorurteile eine falsche, aber extrem einflussreiche Bedeutungszuschreibung ("Türke" als Betrüger) erzeugen können, die die tatsächliche Herkunft überlagert und das Wort mit ideologischer Aufladung versieht.
3. Verankerung von Sprache in Kultur und Geschichte: Wie historische Ereignisse (Türkenkriege) und kollektive Mentalitäten (Vorurteile gegenüber dem Osmanischen Reich) die Bedeutung und Konnotation eines Wortes nachhaltig prägen. "Türken" ist ein sprachliches Fossil, das die Abgründe des interkulturellen Missverständnisses und der Fremdenfeindlichkeit vergangener Jahrhunderte bewahrt.
4. Verantwortung im Sprachgebrauch: Die Kenntnis dieser komplexen Geschichte mahnt zur Vorsicht. Auch wenn die etymologische Verbindung zu "Türke" falsch ist, "wirkt" das Wort im heutigen Kontext oft rassistisch belastet. Sein Gebrauch erfordert Sensibilität, da die volksetymologische Assoziation im kollektiven Bewusstsein tiefer verankert ist als die wissenschaftliche Wahrheit.
Wie Grass' Oskar, der die Wahrheit "türkt", während er über das "Türken" nachdenkt, so täuschen auch wir uns oft über die wahren Ursprünge der Dinge. Manchmal steckt in einem einzigen Wort die ganze Geschichte eines Kontinents – mit all seinen Widersprüchen, Projektionen und ungelösten Spannungen. Die Etymologie von "türken" mahnt uns, dass Worte nicht nur bedeuten, sondern auch "wirken", und dass ihre wahre Bedeutung oft in den Schichten ihrer eigenen Geschichte verborgen liegt.
Bibliographie
I. Wörterbücher und Nachschlagewerke
Cortelazzo, Manlio & Paolo Zolli: Dizionario Etimologico della Lingua Italiana. 5 Bde. Bologna: Zanichelli, 1979–1988.
De Mauro, Tullio: Grande Dizionario dell'Uso Italiano. 3 Bde. Turin: UTET, 1999.
Drosdowski, Günther et al. (Hrsg.): Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 10 Bde. Mannheim: Dudenverlag, 1999.
Kluge, Friedrich & Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 24., durchges. u. erw. Aufl. Berlin: de Gruyter, 2002.
Wolf, S. A. (Hrsg.): Wörterbuch der deutschen Gaunersprache. Straelen: Straelener Manuskriptverlag, 1985.
II. Sprachhistorische Fachliteratur
Grebe, Paul (Hrsg.): Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 2., neubearb. u. erw. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1959.
Grammatik mit etymologischen Hinweisen; Kap. "Wortbildung und Entlehnung" (S. 712–728).
Mitzka, Walther: Schicksale deutscher Wörter*. Berlin: de Gruyter, 1960.
Fallstudien zur Wortgeschichte; Kap. "Türken" (S. 84–92).
Polenz, Peter von: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. II: 17. und 18. Jahrhundert. Berlin: de Gruyter, 1994.
Standardwerk zur Sprachgeschichte; Kap. "Entlehnungen aus dem Romanischen" (S. 210–220).
Rohlfs, Gerhard: Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten. 3 Bde. Bern: Francke, 1966–1969.
Grundlagenwerk zur italienischen Sprachgeschichte; Bd. I, § 124 (Semantik von
truccare).
Störig, Hans Joachim: Abenteuer der Sprache. Hamburg: Rowohlt, 1959.
Einführung in Sprachwissenschaft; Kap. "Volksetymologie" (S. 112–125).
III. Philosophische, psychologische und kulturwissenschaftliche Grundlagentexte
Canetti, Elias: Masse und Macht. Hamburg: Claassen, 1960.
Kulturpsychologische Analyse; Kap. "Der Türke als Machtphänomen" (S. 408–415).
Jaspers, Karl: Psychologie der Weltanschauungen. Berlin: Springer, 1919.
Theorie kollektiver Projektionen; Kap. "Das Unbewusste in der Gemeinschaft" (S. 240–250).
Vico, Giambattista: Scienza Nuova. Neapel: Mosca, 1725.
Sprachphilosophisches Grundlagenwerk; Libro II, "Del vero e del falso" (S. 145–160).
IV. Primärliteratur (Literarische Zeugnisse)
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. Hrsg. von Rolf Tarot. Tübingen: Niemeyer, 1967 [Orig. 1668].
Kontext: Cap. 10 ("Er türkte die Karten...").
Grass, Günter: Die Blechtrommel*. Neuwied: Luchterhand, 1959.
Kontext: Kap. 23 ("Oskar türkte die Wahrheit...").
Luther, Martin: Eyn Sermon von dem Türcken zu Rom. Wittenberg: Rhaw, 1529.
In: Weimarer Ausgabe (WA), Bd. 30/II, S. 160–168.
Mann, Thomas: Buddenbrooks. Verfall einer Familie. Berlin: Fischer, 1901.
Kontext: 6. Teil, 8. Kapitel ("Das ist getürkt!...").
Opitz, Martin: Trost-Gedichte in Widerwärtigkeit des Krieges. Breslau: Müller, 1633.
Kontext: Gedicht III, V. 42 ("Wer türkisch denkt...").