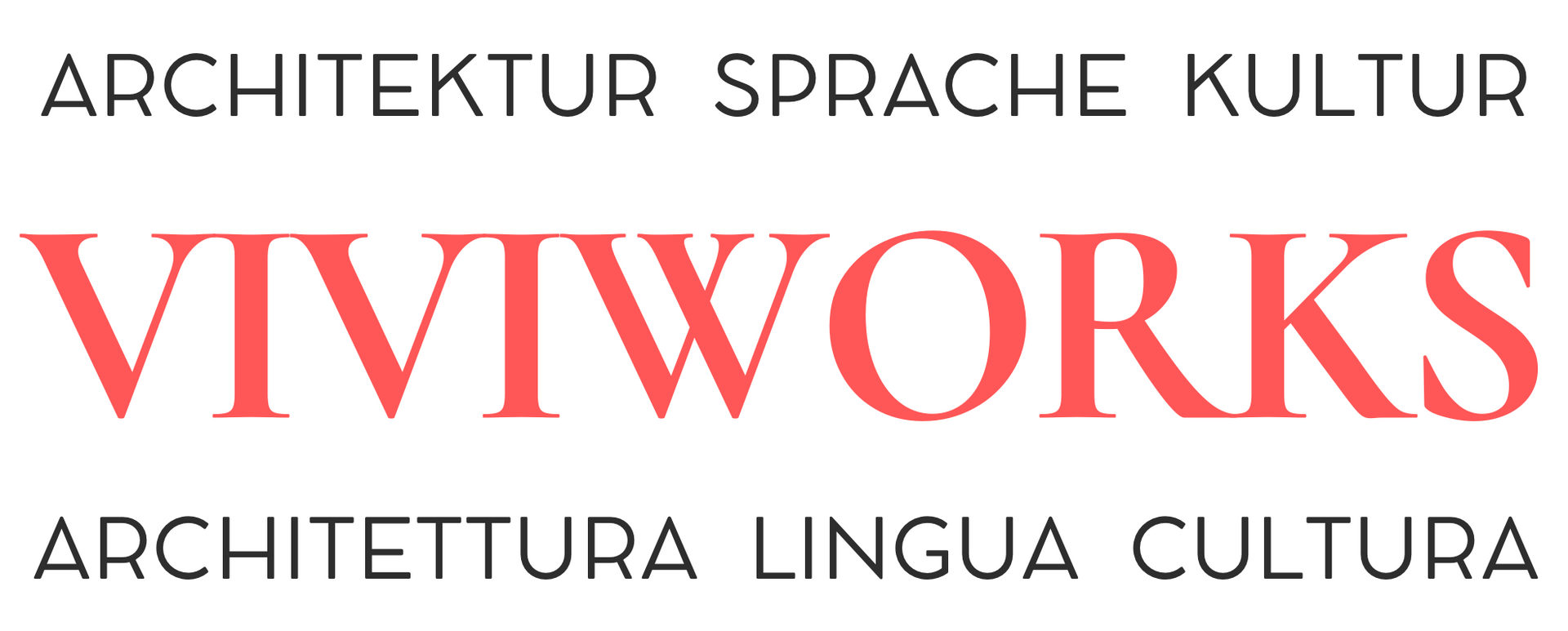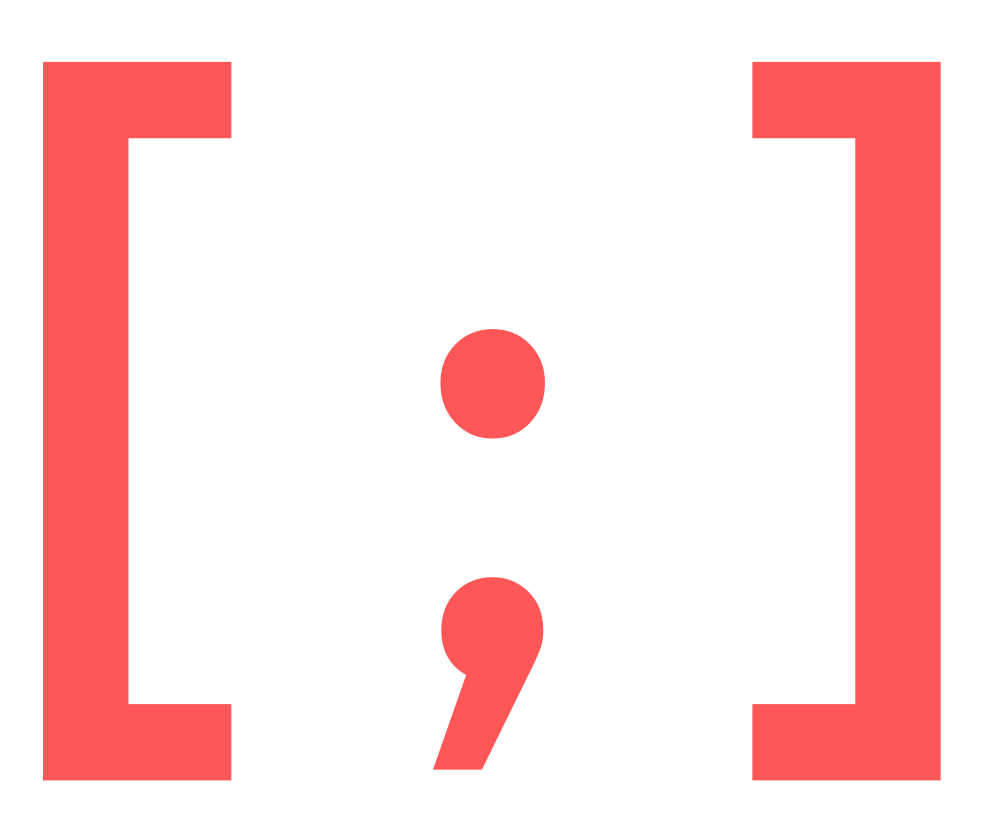
Friede oder Frieden?
Die beiden Begriffe „Frieden“ und „Friede“ sind ein sprachlicher Glücksfall, ein feiner Unterschied im Deutschen, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt und doch ein weites Feld für Reflexion erschließt.
Friede und Frieden – Zwei Gesichter der Sehnsucht
Das Wort „Friede“ trägt die Aura des Ursprungs. Wer es spricht, ruft etwas Feierliches, fast Heiliges auf. Es ist der Gruß, mit dem sich Menschen über Zeiten und Kulturen hinweg begegnen – „Friede sei mit dir“ –, ein Zustand, der mehr meint als die bloße Abwesenheit von Konflikt.
„Friede“ ist ein Seelenraum, eine Einkehr, das Gleichgewicht, das die Welt im Inneren wie im Äußeren sucht.
„Frieden“ hingegen klingt nach Vertrag, nach Paragraph und Politik. Der Begriff ist prosaischer, moderner, oft Gegenstand von Verhandlungen und diplomatischen Schlussakten. Wir „schließen Frieden“, wir „wahren den Frieden“, als handele es sich um ein kostbares Gut, das gesichert und verwaltet werden muss – und zugleich immer gefährdet ist.
Germanisten und Philosophen haben diesen Dualismus oft diskutiert. Der „Friede“ als poetischer Urzustand, der „Frieden“ als historischer Kompromiss; Goethe, der „mit der ganzen Welt Friede halten“ will, nachdem er ihn in sich gefunden hat, und Kant, der den politischen „ewigen Frieden“ als Ziel der Vernunft entwirft. Es scheint, als blickten beide Begriffe von den Enden einer Brücke aufeinander zu – die persönliche Eintracht und die gesellschaftliche Ordnung.
Sprachlich ist die Differenz ein leiser Hinweis auf die Beweglichkeit des Deutschen, das noch Nuancen kennt, wo in anderen Sprachen lediglich ein Wort steht. Etymologisch verbindet beide das althochdeutsche fridu, das „Schonung“, „Freundschaft“, „Freiheit“ und „Ruhe“ bedeuten konnte. Historisch war „Friede“ stets das Ziel, das errungen und gestiftet werden musste, selten einfach so gegeben.
Doch der Mensch sucht beides: Den „Frieden“ als Zustand der Welt, ohne Tod und Gewalt, und den „Friede“ als inneren Halt, der das Leben trägt.
Marie von Ebner-Eschenbach hat diese Dialektik schön auf den Punkt gebracht:
„Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst.“Der Friede, so verstanden, beginnt immer im eigenen Herzen.
Erst wenn wir ihn dort eingehen, kann er zum Frieden in der Welt werden – als Verheißung und als Aufgabe. Der philosophische „Friede“ und der politische „Frieden“ sind so zwei Seiten einer Münze, zwischen denen das menschliche Dasein pendelt, ewig auf der Suche nach „ein wenig mehr Friede“ im eigenen Leben und „ein wenig mehr Frieden“ um sich herum.
So stiften wir, indem wir unterscheiden, ein neues Verständnis zur gleichen alten Sehnsucht: Dass irgendwann Friede herrscht – und der Frieden bleibt.
Quellen
- Wikipedia: Friedensbegriff und wissenschaftliche Unterscheidung von negativem und positivem Frieden
(inkl. Bezug auf Johan Galtung und Definitionsgeschichte)wikipedia - Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg – Theorien des Friedens (u.a. Galtung, demokratischer Friedensbegriff, systematische Friedensforschung)lpb-bw
- Wissenschaft & Frieden (Fachzeitschrift) – Artikel „Wissen, wovon wir reden“ mit Begriffsgeschichte und Diskussion sozialer Aspekte des Friedenswissenschaft-und-frieden
- Friedensforschung, Gewaltpolitik und Gesellschaftskritik:
Bundeszentrale für politische Bildung – Friedensforschung als kritische Wissenschaft, Definitionen und Kritik traditioneller Friedensbegriffebpb - Universität Basel – Diskursive Analyse des Friedensbegriffs, Konfliktforschung („Frieden ist heute ein umstrittener Begriff.“)unibas
Viele dieser Quellen greifen Johan Galtungs Konzept von „negativem“ und „positivem“ Frieden auf, diskutieren unterschiedliche Friedenskonzepte und die Entwicklung des Begriffs aus interdisziplinärer Sicht (Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie).
- https://www.lpb-bw.de/demokratie-und-frieden
- https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/530482/frieden-ist-mehr-als-kein-krieg-gewaltpolitik-als-problem-der-friedensforschung/
- https://de.wikipedia.org/wiki/Frieden
- https://www.propeace.de/de/friedenslogik-statt-sicherheitslogik
- https://wissenschaft-und-frieden.de/artikel/wissen-wovon-wir-reden/
- https://www.europaimunterricht.de/fileadmin/europaimunterricht/pdf/Unterrichtseinheiten/due_2016_frieden_und_sicherheit_ziele_mittel.pdf
- https://d-nb.info/1256596736/34
- https://phaidra.univie.ac.at/open/o:1282396
- https://www.zaoerv.de/13_1950_51/13_1950_1_a_27_56.pdf
- https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Uni-Nova/Uni-Nova-143/Uni-Nova-143-Gespraech.html